 Das Menetekel unserer Zeit steht längst geschrieben, doch es leuchtet nicht mehr an Palastwänden, sondern in den Oberflächen unserer Bildschirme, in den Rhetoriken unserer Selbstinszenierung und in den stillen Verschiebungen unseres Wirklichkeitsbewusstseins. Der Mensch begegnet sich heute vor allem als Bild: als kuratierte Version seiner selbst, als Projekt, das es zu optimieren, zu vermarkten, zu glorifizieren gilt. Narzissmus ist unter diesen Bedingungen nicht mehr bloß eine individuelle Charakterverirrung, sondern die schweigende Grundhaltung einer Epoche, die das Ich zur obersten Instanz erhebt. Das Subjekt kniet nicht mehr vor einem Gott, sondern vor seinem eigenen Spiegelbild – und hält dies für einen Akt der Befreiung.
Das Menetekel unserer Zeit steht längst geschrieben, doch es leuchtet nicht mehr an Palastwänden, sondern in den Oberflächen unserer Bildschirme, in den Rhetoriken unserer Selbstinszenierung und in den stillen Verschiebungen unseres Wirklichkeitsbewusstseins. Der Mensch begegnet sich heute vor allem als Bild: als kuratierte Version seiner selbst, als Projekt, das es zu optimieren, zu vermarkten, zu glorifizieren gilt. Narzissmus ist unter diesen Bedingungen nicht mehr bloß eine individuelle Charakterverirrung, sondern die schweigende Grundhaltung einer Epoche, die das Ich zur obersten Instanz erhebt. Das Subjekt kniet nicht mehr vor einem Gott, sondern vor seinem eigenen Spiegelbild – und hält dies für einen Akt der Befreiung.
In dieser Selbstanbetung beginnt ein kaum bemerktes, doch folgenreiches Abgleiten: der schleichende Verlust der Welt. Wo der Blick unablässig auf das eigene Innere, auf die eigene Wirkung, auf das eigene Bild gerichtet ist, verliert die äußere Wirklichkeit an Schärfe, an Widerständigkeit, an Bedeutung. Die Welt wird nicht mehr als eigenständige, unverfügbare Realität erfahren, sondern als Bühne, Rohmaterial, Kulisse für die Inszenierung des Selbst. Die anderen erscheinen weniger als Gegenüber, denn als Publikum oder Spiegel; Dinge und Ereignisse werden nicht um ihrer selbst willen wahrgenommen, sondern nach ihrem Nutzen für das eigene Narrativ bewertet. So erodiert Schritt für Schritt das Bewusstsein dafür, dass Wirklichkeit mehr ist als das, was dem eigenen Selbstbild zuträglich ist.
Aus dieser Entfremdung folgt die Blindheit, aus der Blindheit der Größenwahn. Wer die Welt nur noch in dem Maß gelten lässt, in dem sie sich dem eigenen Willen, den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Deutungen fügt, überschreitet unmerklich die Grenze vom Selbstbewusstsein zur Selbstvergötzung. Der Mensch beginnt, sich als Schöpfer der Wirklichkeit zu verstehen, nicht mehr als deren Teil. Wahr ist, was sich durchsetzen lässt; gut ist, was das eigene Bild bestätigt; wirklich ist, was sich in das gewünschte Narrativ einfügt. Diese Haltung erzeugt eine gefährliche Illusion von Allmacht: Wenn alles gestaltbar scheint, auch Wahrheit und Sinn, dann wird jegliche Grenze als Zumutung erlebt, jede Widerrede als Angriff, jeder Widerstand als bloße Störung eines an sich legitimen Herrschaftsanspruchs des Ich.
Doch die Wirklichkeit, so sehr man sie auch umdeuten, designen, relativieren mag, bleibt in einem entscheidenden Sinne unbeugsam. Sie lässt sich verschieben, verleugnen, vertagen, aber nicht endgültig abschaffen. Der Größenwahn des Subjekts, das sich als souveräner Schöpfer seiner Welt begreift, stößt früher oder später auf Fakten, die sich nicht einhegen lassen: auf soziale, ökologische, psychische, politische Grenzen. An diesen Grenzen prallen narzisstische Entwürfe, identitäre Selbstmythologien und grandiose Zukunftsversprechen hart auf das, was sich der Verfügung entzieht. In diesem Moment beginnt der Traum der Selbstvergötzung zu reißen – und was als höchste Krönung des Ich gedacht war, schlägt um in Erfahrung der eigenen Ohnmacht.
Die Katastrophe, von der hier die Rede ist, ereignet sich nicht erst im spektakulären Zusammenbruch von Systemen, im sichtbaren Scheitern von Projekten oder im dramatischen Untergang von Kulturen. Sie beginnt leiser: in der inneren Leere hinter der Fassade permanenten Selbstentwurfs, in der Unfähigkeit, das andere um seiner selbst willen gelten zu lassen, in der schwindenden Bereitschaft, sich von der Wirklichkeit korrigieren zu lassen. Katastrophe ist zunächst der Verlust der Fähigkeit zur Selbstbegrenzung. Wo der Mensch nicht mehr anerkennt, dass er ein endliches Wesen in einer nicht von ihm geschaffenen Welt ist, da tritt an die Stelle von Verantwortung eine maßlose Steigerungslogik: mehr Selbstoptimierung, mehr Reichweite, mehr Einfluss, mehr Verfügung – und damit mehr Entfremdung.
Wer so lebt, ruft seinen eigenen Untergang herbei und nennt ihn seine Krönung. Denn die letzte Konsequenz des narzisstischen Zeitalters ist nicht Erfüllung, sondern Erschöpfung: die Erschöpfung der inneren Ressourcen, weil kein Selbstbild den unstillbaren Hunger nach Bestätigung zu stillen vermag; die Erschöpfung der zwischenmenschlichen Beziehungen, weil andere Menschen in der Logik der Selbstvergötzung letztlich nur Funktionen des eigenen Dramas bleiben; und schließlich die Erschöpfung der Welt, die unter dem Anspruch leidet, grenzenlos verfügbar zu sein. Der Untergang äußert sich daher doppelt: als Zerfall innerer Integrität und als Zusammenbruch äußerer Strukturen, die überfordert, übernutzt, überformt wurden.
Das Menetekel unserer Zeit besteht darin, dass diese Dynamik nicht mehr als Gefahr, sondern als Ideal verklärt wird. Narzissmus heißt heute Selbstbestimmung, Realitätsverlust erscheint als kreative Freiheit, Größenwahn tarnt sich als visionärer Fortschritt, und die Vorboten des Untergangs werden als notwendige „Transformation“ gefeiert. Gerade darin liegt der Ernst der Lage: Eine Kultur, die ihren eigenen Destruktionsprozess begrifflich als Vollendung deutet, raubt sich die Möglichkeit zur Umkehr. Sie verwechselt Selbstüberwindung mit Selbststeigerung und hält die wachsende Kluft zur Wirklichkeit für einen Beweis ihrer Souveränität.
Demgegenüber wäre eine Haltung nötig, die das Maß des Menschlichen wieder ernst nimmt: eine Wiederentdeckung der Welt als Gegenüber und nicht bloß als Bühne, der Wahrheit als etwas, das nicht beliebig formbar ist, und der anderen Menschen als Mitwesen, nicht als bloße Kulisse des eigenen Entwurfs. Nicht die Abschaffung des Ich steht an, sondern seine Rückkehr in eine Ordnung, in der es nicht Gott sein muss, um würdig zu sein. Erst wenn der Mensch die Hybris der Selbstvergötzung hinter sich lässt, kann er der Katastrophe entgehen, die er so lange für seine Krönung hielt.



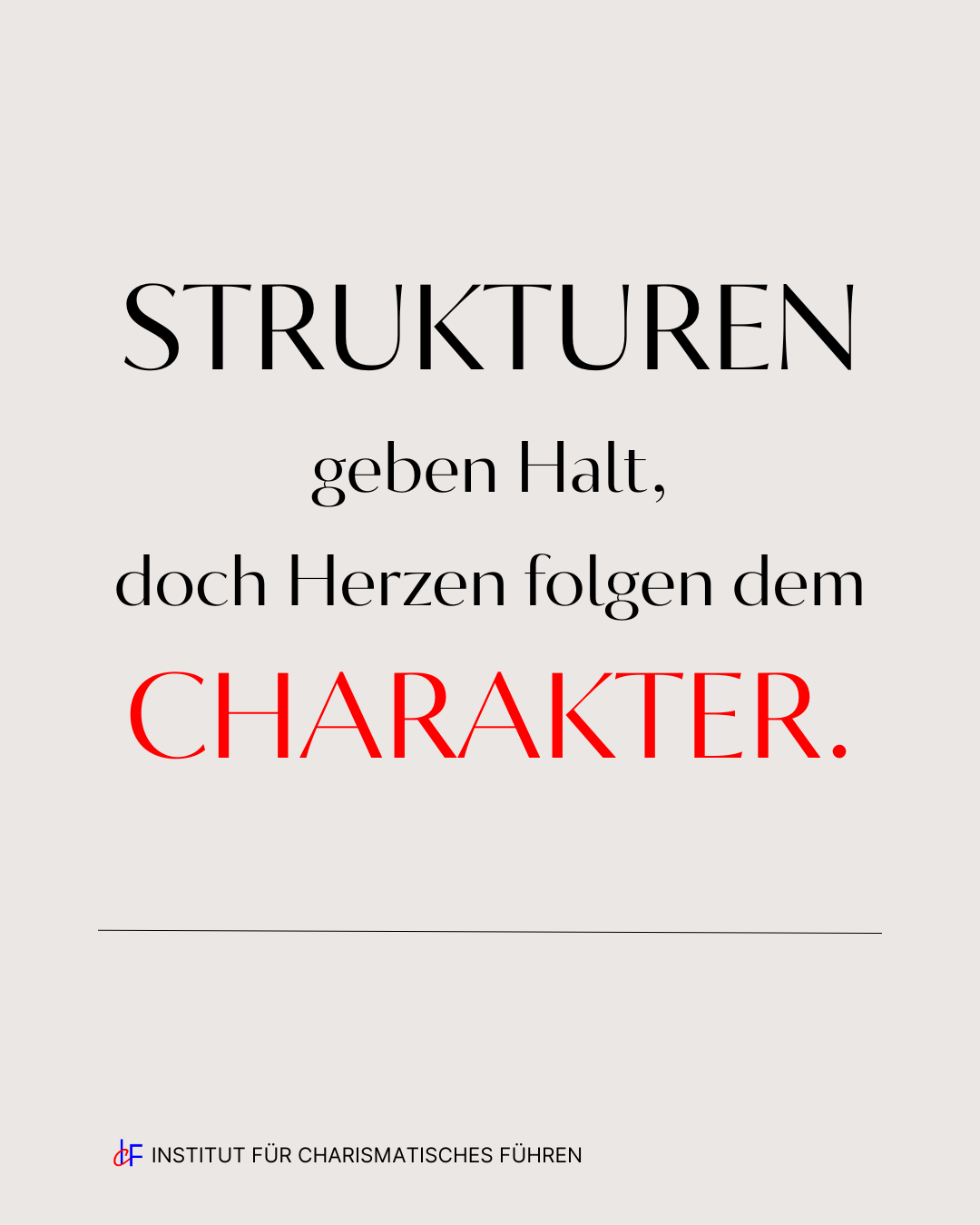
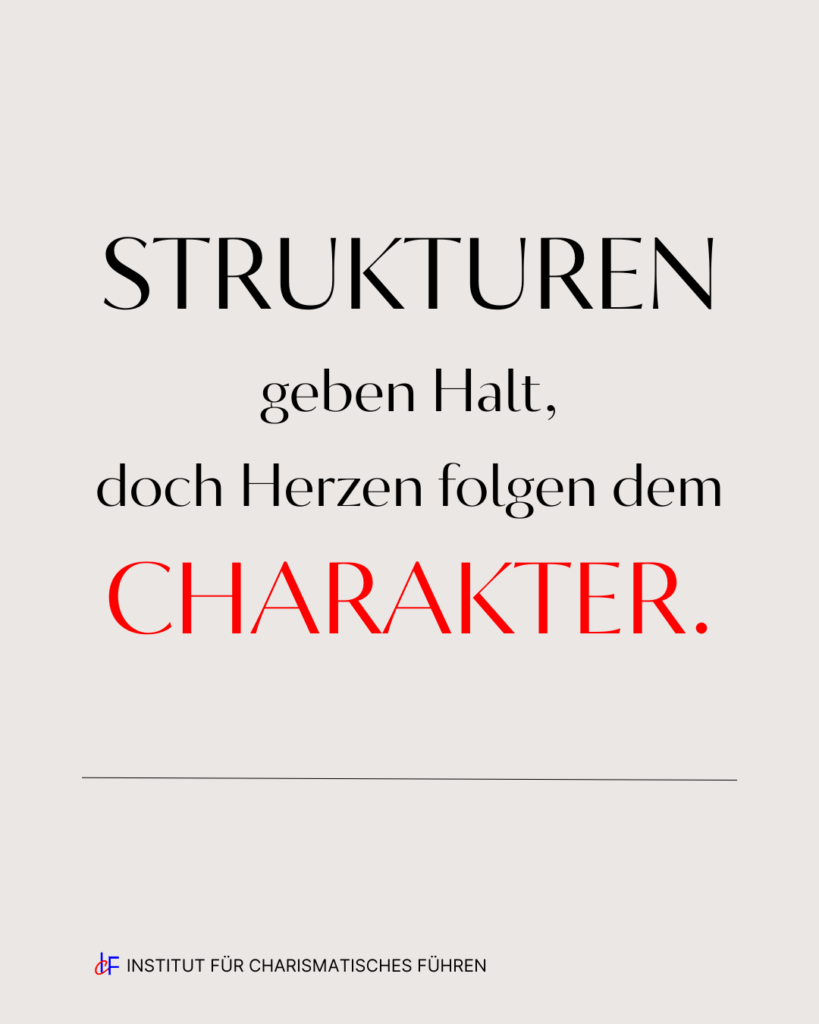 Über die Kraft von Charakter in Zeiten struktureller Erstarrung
Über die Kraft von Charakter in Zeiten struktureller Erstarrung